
Nirgends wird der Beginn des Denkens sowie der Antrieb seines Schreibens als Modus der Reflexion der Umwelt so deutlich wie in diesem Frühwerk. Themen, die ihn zeitlebens beschäftigen werden, sind hier bereits präsent: schwache Männer, Femme fatale, das dekadente Bürgertum samt seiner immanenten Ödnis im verordneten und genossenen Nichtstun, sadomasochistische Formen der Sexualität, Herrschaft und Unterdrückung allgemein. Während Heinrich Mann jedoch diese Verhältnisse in seinen nachfolgenden Werken persifliert und/oder ihnen mit beißendem Zynismus begegnet, steht Heinrich Mann in diesem Frühwerk jener Modus der Distanzierung noch nicht zur Verfügung. Der stattdessen eingesetzte auktoriale Erzähler, der als allwissende Instanz die Psyche aller Familienmitglieder mit Röntgenaugen durchleuchtet, und außerdem eindeutig einen Hang zu überbordender Reflexion sozialer Verhältnisse und psychischer Beweggründe aufweist, versagt gänzlich als Erzählmodus in den Augen heutiger Lesender. Das aber kann dem Autor wohl kaum angelastet werden! Schließlich haben heutige Rezensent*innen zu bedenken, dass dieses Werk aus den Jahren 1892-4 stammt.
Für die damalige Zeit ist die darin erzählte Variante der Kreuzbeziehung an und für sich wohl durchaus gewagt, denn hier beginnt der Schwiegersohn eine Liaison mit der Schwiegermutter, während der Vater nicht von der ständigen Gegenwart der Tochter lassen kann.
Der 32-jährige Wellkamp will – nach der einen oder anderen amoureusen Affäre, in der er sich stets den geliebten Frauen schmerzlich unterlegen fühlte – die 17-jährige Anna heiraten. Sie verkörpert den Typus der neuen Frau: Gebildet, an Politik interessiert, belesen – eine Anhängerin Bebels –, in sich ruhend, ernst; sie wirkt mit Verlaub eher wie Mitte 40, denn wie eine 17-jährige. Annas Vater, Major a. D. von Grubeck, ist in zweiter Ehe mit der 28-jährigen exotischen Dora verheiratet, eine Kreolin, deren umfangreiches Vermögen Vater wie Tochter ein bequemes Leben bis zum Tod garantieren sollte. Hierzu wurde diese Verbindung eingegangen, die offenbar weder sexuell noch auf Basis einer emotionalen Bindung je vollzogen wurde. Schon Kommunikation findet kaum statt, lieber reitet der Vater mit der Tochter jeden Vormittag aus. Um die Dissonanzen in seiner Ehe weiterhin ignorieren zu können, drängt der Vater auf Anwesenheit der Tochter, das frisch vermählte Paar möge in die Nachbarwohnung einziehen, eine Verbindungstür wird gar durchgebrochen; die zunehmende Bitternis seiner Ehefrau ignoriert der Major ebenso geflissentlich wie das Konkurrenzverhältnis der beiden Frauen zueinander: In den Augen Doras hat Anna alles: die Liebe des Vaters, die Liebe des Ehemannes – während ihr nichts bleibt als die Einsamkeit der Tagträumereien, aus denen sie sich zu nichts aufzuraffen weiß. Lesen? Anna ist belesener. Ausgehen? Anna hinkt nicht. Nur die Oper in ihrer emotionalen Dichte, der weder Anna noch ihr Vater etwas abgewinnen können, bleibt ihr. Just an diesem Ort beginnt die Beziehung Wellkamps zu Dora, und dies Hals über Kopf. Zwar erinnert sich Wellkamp – zitierend gar! – an Elend und Untergang in Goethes »Wahlverwandtschaften«, doch zu einem aktiven ›Nein!‹ vermag er sich nicht aufzuraffen. Da der Fremdgang samt emotionaler Verwicklungen in der Familie stattfindet, wird jeder Versuch Doras zu einem freundlichen Wort mit dem Major oder von Wellkamp zu Anna, um so den Schein zu waren, zur Tortur für den jeweilig anderen amoureusen Partner bzw. die Partnerin. Eifersucht, Rachegedanken und überbordender Hass keimen: Alle sollen gedemütigt werden, alle anderen, außer man selbst. Zusehends entwickelt sich eine sadomasochistische Dynamik, der Familienalltag wird zum Kampfgebiet, das Kräfte zehrt. Bald bringt keiner von beiden Seitenspringer*innen auch nur zum Schein minimale Aufmerksamkeit für den oder die jeweiligen Ehepartner*in auf. Hass, Verachtung, Bitterkeit dominieren. Schon ist der Abgrund nicht weit: Die Liaison fliegt auf, weil Dora und Wellkamp im Streit die Ankunft der Reitfreudigen nicht bemerken, die an diesem Morgen gar nicht aufbrachen …
Im Gegensatz zu anderen Werken solchen Inhalts jener Zeit, verzeiht Anna ›vernünftig‹, da sie ›eigene Mitschuld‹ am Verhängnis ortet – was im Roman als ungemeine Stärke dargestellt wird. Woraufhin der Major kaum anders agieren kann, als sich in alles zu schickten, erleichtert außerdem, schließlich stand doch sein gemütliches Alltagsleben, seine Bequemlichkeit auf dem Spiel: Da alles in der Familie geblieben sei, könne man es ruhig unter den Teppich kehren, schlussfolgert er. Nur sollte das junge Paar nun vielleicht doch lieber ein eigenes Domizil beziehen, in dem einzig der Vater sie als gern gesehener Gast besuchen werde. Nicht jedoch Dora. Die tut derweilen allen anderen ohnedies den Gefallen, in Folge der Ereignisse erst einmal ordentlich zu erkranken, physisch wie psychisch. Bis sie final mit dem Revolver ihres Mannes in der Hand auf der Eingangsmatte zu Annas und Wellkamps neuem Zuhause steht, um gnädiger Weise an der Türschwelle an Herzversagen zu sterben, bevor sie Anna oder sich selbst vor aller Augen erschießen kann, und damit sicherlich den dicken Teppich unmöglich gemacht hätte. So aber darf Wellkamp sich einige Stunden als Schuldiger an Doras Tod fühlen, darf Anna anstelle des überforderten Papas einen einfühlsamen Brief an Doras Vater schreiben, während ihr eigener Vater nun in das traute Heim des jungen Paares zieht, das sich einen Sohn wünscht, damit das Glück vollkommen sei, während über Doras Grab Gras wächst, und alles in der Familie bleibt …
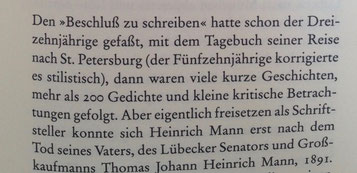
Wie schon erwähnt entstand dieser Roman 1892/93 und erschien im folgenden Jahr aufgrund der finanziellen Unterstützung von Heinrich Manns Mutter. Die Figur Doras ist ob ihrer Verwurzelung in Lateinamerika und ihrer kreolischen Abstammung eine Protagonistin, die kaum verhüllt an Heinrich Manns Mutter Julia angelehnt ist, zu der er ein diffiziles, libidinös aggressives Verhältnis hatte. Im Gegensatz zu Heinrich Manns Vater, der selbst im Testament ein versuchtes Verbot der künstlerischen Betätigung Heinrichs aussprach, förderte die Mutter das künstlerische Schaffen ihrer Söhne explizit. Wer die literarische Qualität des Romans beurteilen will, sollte dennoch mE nicht bloß neugierig in Familienverhältnissen wühlen, sich zudem unbedingt davor hüten, den Roman aus heutiger Sicht stilistisch zu beurteilen: Wir stehen gerade am Anfang der Moderne, der Roman in seiner Theorie beginnt am auktorialen Erzähler zu sägen, den er ob seines eingeschränkten Aktionsradius’ nicht mehr will, aber eben bislang nicht so recht zu ersetzen weiß. Es sei in Erinnerung gerufen, dass erst sieben Jahre später erstmals im Feuilleton Arthur Schnitzlers »Leutnant Gustl« erschien, seine fulminante Bewältigung der Erzählperspektiv aus der Psyche einer Figur heraus gar erst 1926 in der »Traumnovelle« folgte. Erst 1914 begann James Joyce seinen »Ulysses«, und Virginia Woolfs Aufbrechen der Erzählhaltung wäre gleichfalls um den ersten Weltkrieg zu datieren. Weshalb dies von Belang ist? Weil manche Rezensent*innen, die nach der Wiederauflage dieses Romans, an Konzept wie Sprache, an (wahrhaftig überbordender) auktorialer Deutungslust herummäkelten, gut daran getan hätten, diese Entstehungsgeschichte der Erzählperspektive in der Prosa zu bedenken. Heinrich Mann jedoch macht es ihnen in einer wohl für ihn typischen Manier durchaus leicht, harsch Kritik zu üben, wenn er über dieses mit 21 Jahren verfasste Werk in seiner Wiederauflage schreibt: »Diesen Roman schrieb ich so früh, daß ich unmöglich noch zu ihm stehen kann wie ein Autor zu seinem Buch. Während der Bearbeitung für die neue Ausgabe war es mir oft, als beschäftige ich mich mit dem Werk eines jungen Menschen, der einst meinesgleichen gewesen, mir aber schon längst aus den Augen gekommen wäre. Um die Beziehung wieder herzustellen, war ich versucht, ihm einen Brief zu schreiben. Antwort ist nicht erfolgt. Man verständigt sich so schwer mit seiner Vergangenheit.« Es sei ihm zur Antwort gegeben, dass »In einer Familie« dennoch für all jene von Interesse sei, die wissen wollen, wie begann, was »Professor Unrat« wie auch »Untertan« zu großartigen Werken werden lässt, und die den Mut des jungen Autors, auch ob dieses inhaltlichen Wagnisses, zu schätzen wissen.

Wir mögen den französischen Autor Paul Bourget skeptisch beäugen, dem Heinrich Mann nicht bloß seinen Erstling widmete, sondern dessen Grundsatz, das narrative Gestalten habe vor allem die Psychologie zu fokussieren und zu vermitteln, uns aus jeder Silbe von Manns auktorialem Erzähler entgegen atmet. Bourget entwickelte jenes Konzept der Neuen Romantik damals im Kontrast zum Naturalismus, welcher vor allem die Darstellung der Auswirkungen sozialer Verhältnisse fokussierte. Bourget, von etwa 1890 bis 1914 vielfach bejubelter Autor, ist heute vergessen. Uns gilt er vor allem als ein Vertreter der Analyse und als konservativer Kritiker der Dekadenz des Fin de Siècle. Seine Überzeugung ›les familles font les pays, puis les races‹ samt seiner Betonung der Familie als Hort des inneren Friedens nach konfliktreichen Kämpfen, wirkt aus heutiger Sicht auf psychologische Dynamiken doch recht vereinfacht und idyllisiert; ebenso wie Heinrich Manns Zwinges der Erzählflusses in jene Mündung: Wellkamp muss nach allen Kämpfen glücklich in der Ehe ankern, damit von ihm gesagt werden kann: »Das echte, stetig geordnete, einträchtige und in seinem unscheinbaren Frieden so inhaltsreiche Leben in einer Familie.«
Jungen, zeitgenössischen Autor*innen sei dies Exempel einer beflissentlichen Umsetzung einer gerade eben modernen Romantheorie eines anderen zur Warnung mitgegeben.
Quelle:
Mann, Heinrich: In einer Familie. Frankfurt a.M.: S. Fischer Verlag 2000.
Schröter, Klaus: Nachwort. In: In einer Familie. Frankfurt a.M.: S. Fischer Verlag 2000.
