
Zwanzig war Maria Lazar als sie »Die Vergiftung« schrieb, ein frappierendes Werk, welches ich allen Literaturinteressierten wärmstens empfehlen kann: Ein schmaler Band, eine expressionistische Erzählung, kein Roman im herkömmlichen Sinn. Vielmehr würde ich es die Betrachtung einer Familie in dreizehn Bildern nennen:
Ruth, gerade eben erwachsen geworden, befindet sich im Ablösungsprozess von ihrer Mutter. Mit kritischen Augen und entlarvendem Blick nimmt sie die Welt des Bürgertums wahr, in der vor allem Sein der schöne Schein steht. Den gilt es unbedingt zu wahren, ebenso wie alle Normen der eigenen Gesellschaftsschicht einzuhalten sind, selbst wenn diese daran zugrunde geht. Ruth jedoch begehrt auf. Will sich nicht einfügen in ein Leben, welches für sie vor allem das brave Warten auf einen heiratswilligen Herren vorsieht, möglichst mit Reichtum gesegnet, den die Mutter mit Lug und Trug umgarnen würde, bis der Pakt endlich beidseits zur Ehe verpflichtet, sodass man schließlich die Finanzverhältnisse, die nur ›heruntergekommen und beengt‹ genannt werden können, auf den Tisch legen darf. Ein ersticktes Aufbegehren ist Ruths Widerborstigkeit, denn es fehlt ihm am entscheidenden Ausweg: der Möglichkeit einer eigenständigen Existenzsicherung.
Obige Andeutung der Story wird dem Werk Lazars trotz inhaltlicher Korrektheit in keiner Weise gerecht, da das Wesentliche bislang außer Acht gelassen wurde: Das Wie ihres Erzählens, welches für ein Debüt erstaunlich ist. Erst durch den im Werk angeschlagenen Erzählton wirkt die lähmende Atmosphäre dieses Zusammenlebens so stickig, sodass man Mutter, beiden Töchtern, erwachsenem Sohn und beigeselltem Künstler-Onkel zurufen möchte, die Fenster weit aufzureißen, um endlich Atem in diese freiwillige Knechtschaft zu bringen. Es ist eine harte Sprache, ein eckiger Duktus, der in kristalliner Klarheit benennt, was der Hauptfigur wichtig ist – und alles andere beiseite lässt.

So bleiben Was, Wie, Warum, Wer, Wo teilweise offen. Manches wird später nachgereicht, anderes erschließt sich nie in aller Deutlichkeit: Weil jene Details für Ruth, die sie ohnedies weiß, keine Relevanz haben, bleiben sie ausgespart. Durchaus denkbar, dass zur Entscheidung für diesen Duktus auch das Wissen beitrug, thematisch mehrere ›heiße Eisen‹ der damaligen Leser*innenschaft nonchalant zu offerieren.
Lazars Sprache in diesem Werk lebt von rhythmischen Wiederholungen, sie ist adjektivisch gesättigt – stellenweise auch übersättigt wie man kritisch anmerken könnte.
In jenen dreizehn Bildern mit nüchternen Titeln wie »Der Kleiderkasten« oder »Gute Familie«, »Geld« oder »Gott« werden in ausdrucksstarken, aneinandergereihten Erzählminiaturen kleine Begebenheiten dargestellt, die sich stimmig zum themengebenden Titel fügen und Aspekte der zunehmend sich vergrößernden Kluft zwischen Mutter und Tochter wiedergeben, da Ruth aktiv beginnt, ein eigenes Leben mit eigenen Wertmaßstäben zu führen.
Sie hat ein ›Verhältnis‹ mit einem älteren Mann, einem Chemiker, der eventuell ehedem ihren Eltern nahestand, und der nach dem Tod des Vaters dessen Ideen gewinnbringend für sich selbst vermarkten konnte. Möglicherweise hatte er auch ein Liebesverhältnis mit der Mutter, die nach wie vor seine Briefe hütet, statt in Rage ob seiner verräterischen Machenschaften gegen ihn zu wüten. Welcher Couleur diese Verbindung zwischen Ruth und jenem älteren Mann aufweist, lässt Maria Lazar gleichfalls offen. Genauso wie sie keine Klarheit darüber schafft, ob es sich bei jenem Chemiker um Ruths Vater handelt. Wie vieles andere auch wird dies nur angedeutet. Es bleibt dem Lesenden überlassen, eigene Schlüsse aus dem bruchstückhaft preisgegebenen Leben Ruths zu ziehen.
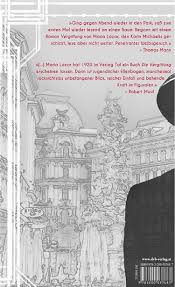
Deutlich wird vor allem der Charakter dieser emotionalen Bindung, ihre Entwicklung. Zu Beginn des Erzählfadens sucht Ruth ihn trotz innerer Widerstände und Abwehr auf. Im Finale der Geschichte beendet sie jene Liaison: Der namenlose Mann hat keine Dominanz mehr. Er, der zuvor so groß und dunkel war, »[…] daß die Dämmerung bleich werden mußte und verdrängt […]« (S. 141), ist bei dieser Offenbarung selbst »[…] bleicher als die Dämmerung […]« (S. 141). Mehr noch: »Und das Zimmer war weich geworden und willenlos ausdehnbar. Ohne Kampfkraft.« (S. 141) Hierin zeigt sich der expressionistische Duktus Lazars, die gerne zur impliziten Darstellung des Innenlebens leblose Objekte nutzt – wie Kleiderkasten, Tür oder den Umgang mit ihnen in Form eines gedeckten Tisches oder verschobenen Mobiliars.
Der erfolglose Künstler-Onkel, der trotz genialer Begabung aufgrund von weichlicher Elanlosigkeit nichts schuf, fungiert in der Erzählung als Gegenüber Ruths. Es wird von der Mutter kritisiert, dass sie, die als Kind der Mutter ähnlich gewesen sei, nun zu seinem Ebenbild geworden wäre: Gesellschaftlich unmöglich, unfähig sich an Normen zu halten, sich einzufügen, sodass die Mutter, die sich einst um ihren Künstler-Bruder ›kümmerte‹, nun glaubt, sich um Ruth ›kümmern‹ zu müssen. Ein spannungssteigerndes Element, denn die Lesenden wissen, dass die Mutter tatkräftig an der Zerstörung seiner Lebenschancen mitwirkte, indem ihr jede Möglichkeit zu minder dünkte, sie jedwede Liaison als Bedrohung seiner in Zukunft möglichen Kunst interpretierte und daher hinter seinem Rücken im Keim erstickte. Einerseits dirigierte und formte sie den jüngeren Bruder, andererseits überhöhte sie ihn zum Genie und verhätschelte ihn; naturgemäß vermutet man nun ähnliche zerstörerische ›Kümmerei‹ um Ruth, und ist folglich wenig erstaunt, die junge Frau knapp nach solcher Ankündigung in ein Sanatorium eingewiesen zu finden, die Hände an das Bettgitter gefesselt.
Auch diese Episode währt kaum länger als einige wenige Zeilen, die Hintergründe für jenen medizinischen Eingriff werden nur angedeutet. Vage bleibt der Charakter dieser »Operation« (S. 122). Neben einer für widerspenstige Frauen damals durchaus üblichen ›Behandlung‹ wegen ›Hysterie‹ wäre auch die Lesart einer Abtreibung denkbar. Der Eingriff wird unter Anwesenheit der Mutter vorgenommen – mit einem Lächeln, was die bereits ein wenig betäubte Ruth durchaus erstaunt registriert: »Sie ist in einer Welt, in der sie noch nie war. Sie muß einmal Ungeheures erlebt haben. Aber hier kann man davon nichts wissen.« (S. 123)
Maria Lazar, die mehrheitlich für Ruth das Pronomen ›sie‹ und für die Mutter die Bezeichnung der Familienstellung ›Mutter‹ nutzt, lässt an einigen Stellen die Pronomen verschwimmen. Wie bei obig zitierten Beispiel. Es obliegt dem Lesenden daher zu entscheiden, lächelt die Mutter (sehr wahrscheinlich) oder lächelt Ruth? Ist Ruth in einer Welt, in der sie noch nie war oder ihre Mutter oder beide? Für alle Deutungsvarianten lassen sich textimmanente Argumente finden.
Maria Lazar scheut auch vor dem Thema sadomasochistischer Strukturen in sexuellen Beziehungen nicht zurück, wenn sie ihrer personalen Erzählerin folgende Worte in den Mund legt: »Sie wollte nicht lieben, nicht Liebe empfangen, aber unterworfen werden.« (S. 76)
Die Mutter, an der sich Ruth reibt, wird gehasst und geliebt – diese Dualität trägt zur differenzierten Darstellung bei: »Kein Mensch weiß, wie groß sie [die Mutter] ist und stolz. Es ist schade, daß das niemand weiß. Aber ich kann es ja auch nicht vertragen, daß sie die Türen zuwirft und durch die Zimmer läuft. Daß sie mit dem Mädchen [Dienstbotin] schreit.« (S. 24) An Stellen wie dieser deutet Ruth an, dass sie darum weiß, dass die Mutter einst gleichfalls in das Korsett ihrer Zeit gepresst wurde, welches ihr eine bestimmte Rolle vorschrieb – und dem künstlerisch begabten Bruder eine andere: »Sie trug ihr kleines Schicksal in krampfhaft zusammengeballten Fäusten. Und erreichte nie etwas […]«, heißt es an einer weiteren Stelle über die Mutter. Oder: »Mutter macht uns alle unglücklich, weil sie nicht glücklich sein kann.« (S. 79) Der Schluss, Mutter sei an allem schuld, drängt sich während der Lektüre auf – und wird durch den Künstler-Onkel revidiert: Hellsichtig fasst der Onkel die Verhältnisse kurze Zeit vor seinem Tod zusammen, wenn er sagt: »[…] die Menschen sind alle Mörder. Aber unsere Nächsten […] das sind unsere nächsten Mörder.« (S. 49) Ein Satz, den man durchaus rund vierzig Jahre später bei den Existenzialist*innen finden könnte, nicht wahr?

Es ist dem Verleger Albert C. Eibl zu danken, dass zwei weitere Titel dieser von den Nationalsozialisten verfemten Literatin, die im dänischen und später im schwedischen Exil unter anderem aufgrund der Unterstützung der Kollegin Karin Michaëlis überleben konnte, für heutige Leser*innen am Markt existieren; eine dritte Wiederauflage von Maria Lazars Werken wird 2020 mit »Leben verboten« folgen.

Auch der dänischen Kollegin Karin Michaëlis soll hier gedacht werden: Wiewohl sie um 1917 eine international anerkannte Literatin war, deren Netzwerk über die Multiplikatorin Eugenie Schwarzwald auch nach Wien und somit in das Zentrum der kulturellen Moderne Österreichs reichte, wurde Karin Michaëlis ebenso vergessen wie Maria Lazar – nicht aber ihr 1910 publizierter Roman »Das gefährliche Alter« über die sexuellen Wünsche einer Frau um die 40 Jahre. Dieser ging als Wortbild in die Alltagsrede ein, gelesen wird er dennoch nicht mehr. Süffisant mag mancher anmerken, dass Michaëlis trotz jenes Romanthemas in ihrem Privatleben nicht besonders von Glück gesegnet war, andere hingegen würden sagen, die Männer ihrer Zeit waren unfähig damit klarzukommen, dass sie als Journalistin und Literatin erfolgreich war und ihr Lebensziel nicht darin bestand, den Herren die Pantoffel zu bringen. Karin Michaëlis war auch diesbezüglich eine bemerkenswerte Frau, dass sie lange vor anderen politisch hellsichtig vor Musolini und Hitler warnte, das allgemeine Kriegstreiben durchschaute oder die Freilassung von Sacco und Vanzetti forderte.

Die Behauptung, die Nationalsozialist*innen hätten eine Rezeption Lazars verhindert und ihr Werk getilgt, ist zwar einerseits wahr, andererseits etabliert es ein Trugbild, denn schon vor deren Machtergreifung konnte Maria Lazar publizieren, was sie wollte, Kollegen unterstützen und fördern, wie sie wollte: Die Männer schwiegen sie im Gegenzug vorzugsweise tot. Man hätte in ihr eben lieber ausschließlich die Muse der Herren gelesen statt ihr eigenes Werk – wie sie uns bis heute in dem Gemälde der »Dame mit Papagei« von Oskar Kokoschka erhalten ist. Maria Lazar wagte ihren Zeitgenoss*innen zu viel, stellte dem international etablierten Vater-Sohn-Gespann frecherweise das weibliche Pendant ganz unverfroren an die Seite, kritisierte Rollenzuschreibungen und -normen implizit, wandte sich vehement gegen Scheinmoral und Verlogenheit des Bürgertums. Sie sprach aus, worüber man im Allgemeinen und als Frau im Besonderen zu schweigen hatte. Nur diese Option existierte für Maria Lazar nicht, da ihr künstlerisches Schaffen ein Muss war: sich schreibend mit den Verhältnissen auseinanderzusetzen stellte ihr eine innere Notwendigkeit dar, um weiterhin in dieser Welt zu leben. Unterstützung hierfür erhielt sie einzig von Frauen. Karin Michaëlis’ Name fiel bereits, Eugenie Schwarzwald sollte noch hinzukommen.

Als Mädchen hatte Maria Lazar deren reformpädagogische Schule besucht, ein revolutionäres Lehrmodell, zu dem wir bis heute noch immer nicht zurückgefunden haben wiewohl es unseren Kindern ermöglichen würde, zu eigenständigem Denken zu finden und als mutige und selbstbewusste Wesen die Klassenzimmer zu verlassen statt mehr oder weniger verkrüppelt aus dem Schulhaus herauszukriechen.
Nach ihrer Matura arbeitete Maria Lazar als Lehrerin in der Schwarzwaldschule, bevor sie 1923 Friedrich Strindberg heiratet– den außerehelichen Sohn Frank Wedekinds und Frieda Uhls, die mit August Strindberg verheiratet war. Die Liaison zwischen Lazar und Friedrich Strindberg ist nicht glücklich. Strindberg flieht bald nach der Geburt der Tochter Judith nach Berlin – um einer anderen Frau den Hof zu machen, doch die gescheiterte Ehe bringt Maria Lazar und ihrer Tochter die schwedische Staatsbürgerschaft ein, was sich während der Jahre des NS-Regimes als Lebensrettung erweisen wird.

Die pekuniäre Lage der Alleinerzieherin ist in Wien häufig bedenklich, weshalb Maria Lazar Übersetzungsarbeiten aus dem Dänischen zu übernehmen beginnt. Für diese Romane besteht durchaus eine größere Leser*innenschaft: Sie werden bejubelt, und die Verlage sind zufrieden, weil diesen Literat*innen die jüdische Abstammung fehlt; das relevanteste aller Argumente gegen Maria Lazar zu jener Zeit, denn schon gegen Ende der 1920er-Jahre agieren die Verlage mehrheitlich lieber feige und wollen abwarten, was geschehen wird, um die zunehmend erstarkenden Nationalsozialisten bloß nicht gegen ihre Unternehmen und ihre Person aufzubringen.
Der Weg von dieser Erfahrung zu der Idee, doch eine dänische Autorin zu fingieren, als deren Übersetzerin Maria Lazar auftreten könne, ist nicht weit. Sie erfindet also Esther Grenen und verhilft dieser fiktiven Literatin zu internationalem Ruhm, denn was Esther sagen darf, darüber hat Maria noch lange zu schweigen. Auch in späteren Exil-Jahren wird ihr dieses Pseudonym noch nutzen …

1933 verlässt Maria Lazar mit ihrer Tochter Österreich, flieht zu Karin Michaëlis, die in ihrem Haus auf Thurø auch Helene Weigel und Bert Brecht aufnimmt. Lazar lebt bis 1935 bei ihr, bevor sie mit Judith nach Kopenhagen übersiedelt, wo sie bis 1939 ein Zuhause finden. Im Exil zu publizieren ist ebenso schwer wie zuvor in Österreich. Maria Lazar schreibt über die schleichende Nazifizierung in »Leben verboten«, die Haltung der Dän*innen gegenüber den Flüchtlingen in »Der blinde Passagier« sowie in »Die Eingeborenen von Maria Blut«, von dem auf Deutsch zu Lazars Lebzeiten nur ein Kapitel in der Exilzeitschrift »Das Wort« erschien.

»Das Wort« wurde ab 1936 monatlich von Bert Brecht, Lion Feuchtwanger, Willi Bredel und Fritz Erpenbeck in Moskau herausgegeben. Angeregt wurde die Gründung dieser Monatsschrift bereits 1935 auf dem ersten »Internationalen Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur«. In ihr schrieb, wer bis heute Rang und Namen in der deutschsprachigen Kunst hat …
1948, an einer unheilbaren Knochenkrankheit leidend, entschied sich Maria Lazar, nicht die Zerstörung ihrer Bewegungsfähigkeit abzuwarten, sondern den Freitod zu wählen:
»Nirgends hingehören, eigene Gedanken haben, eine eigene Überzeugung, einen knappen Stil, der zum Nachdenken zwingt – so was hat keinen Marktwert«, (S. 152) erkannte Eugenie Schwarzwald früh – und wusste um die Größe Maria Lazars jenseits von Markt und Moden.
Quelle:
Lazar, Maria: Die Vergiftung. Wien: Das vergessene Buch 2014.