
Wegen meines Dokumentarfilms »Arbeit statt Almosen«, der in Magdeburg bis 20. Juni im virtuellen Kinosaal des Moritzhofs läuft, trete ich mit Journalist*innen in Österreich sowie in Deutschland in Kontakt. Von einer von ihnen erhalte ich auf meine finalen ›Grüße aus Magdeburg‹ die erstaunliche Antwort, dass ihre »wunderbare Großmutter«, lange schon verstorben, aus Magdeburg stamme, ihre Mutter noch ebenda zur Welt gekommen sei, während sie als waschechte Oberösterreicherin lange schon in Linz lebe – sie hoffe, mich mit diesen Zeilen nicht allzu sehr mit Privatem belangt zu haben. So entschuldigte sie sich für die zwei, drei Erinnerungen an ihre Ahnin, die sie in ihrer e-Mail vermerkt hatte.
›Ganz im Gegenteil‹, lautete meine Antwort. Denn das interessiere mich …
Ihre Zeilen waren mir Grund genug den wohlbekannten Spieß umzudrehen und ausnahmsweise sie um ein Interview zu bitten, der »wunderbaren Großmutter« wegen. Solch ein Zufall sollte doch wohl genutzt werden, nicht?
Überraschenderweise war sie dazu bereit. Wir vereinbarten ein online-Meeting, bei dem sie mir alsdann eine Stunde lang Einblicke in ihre Erinnerungen gewährte und auch Bildmaterial zur Verfügung stellte…
Die Straße, in der ihre Großmutter Ingeborg einst lebte, die wisse sie heute nicht mehr mit Sicherheit zu benennen, aber selbst in den Jahren in Österreich sei Magdeburg immer als Sehnsuchtsort präsent geblieben: ein Synonym für eine wundervolle Kindheit und Jugend. Eine Turmspringerin und eine ausgezeichnete Schwimmerin sei Ingeborg gewesen, die gerne davon erzählte, wie sie in der Elbe den Schiffen nachgeschwommen sei. Erstaunlich sei dies, denn später, bei ihren Enkel*innen, dominierte eher die Sorge, ein Unglück könnte geschehen.

Ingeborgs Vater sei in der heute offenbar nicht mehr existenten Lessing-Apotheke tätig gewesen, ihre Mutter war Hausfrau. Das Wohnhaus der Familie habe sich durch eine ungemein angenehme und verlässliche Hausgemeinschaft ausgezeichnet; beinahe wie eine Großfamilie lebte man miteinander, half aus, wenn es not tat, und unterstützte die anderen, wie man auch selbst von ihnen Unterstützung erfuhr. Dieser soziale Zusammenhalt sei für Ingeborg sehr prägend gewesen, und wohl auch aufgrund dieser Erfahrung, habe sie Zeit ihres Lebens immer Menschen mit offenen Armen aufgenommen, sich um andere gekümmert, sich auf sie eingelassen.
Während ihrer letzten Jahre in Magdeburg, arbeitete sie, bereits eine junge Frau, in einem feinen Geschirrgeschäft am Breiten Weg, vor dem zweiten Weltkrieg der Prachtboulevard der Stadt. In diesem Laden war es Alltag, die Kundschaft in Handschuhen zu bedienen. Auch in späteren Jahren, habe Ingeborg immer wert auf ein gepflegtes Äußeres gelegt, war stets sehr adrett gekleidet – selbst in jenen schweren Zeiten nach Kriegsende, als sie kaum etwas besaß und die finanziellen Verhältnisse allgemein mehr als beengt waren. Da lebte sie bereits im Ausland, im oberösterreichischen Hausruckviertel, in Attnang-Puchheim, um genau zu sein. Darüber wie sie das Unrechtsregime der Nazis empfunden habe, ob sie dagegen, dafür oder indifferent eingestellt gewesen sei, darüber hatte sich Ingeborg ihrer Enkelin gegenüber nie geäußert – und ihre Enkelin niemals nachgefragt. Erst nach dem Tod der Großmutter trat diese Lücke zutage; wie unzählige andere auch, die nie als Frage ausgesprochen worden waren, um Antwort baten; und nun nie mehr gestellt werden konnten.
Weshalb es nicht zur Thematisierung dieses Kapitels der Geschichte gekommen sei?
Das wisse sie nicht zu sagen, antwortet mir die Enkelin.
Auch ich schweige, denke an meine Großeltern – eine ähnliche Erfahrung. Während man miteinander lebt, ist der Alltag und das eigene Sein oftmals dominant. Sie bedingen, dass man vielmals Ereignissen und Gedanken nicht auf den Grund geht, zudem die Zeit, die im Noch der Zukunft zur Verfügung steht, endlos scheint. Zerrt einem der Tod jedoch einen geliebten Menschen von der Seite, ist das Bedauern, was alles nicht gesagt, gefragt, getan und erlebt wurde, auch Teil des Abschiedsprozesses: Die Zeit hat eben nie genügt!
Eines, so die Enkelin, wisse sie auf jeden Fall mit Sicherheit zu sagen: Der Fokus der Großmutter habe die Kriegsjahre über vor allem darauf gelegen zu überleben: Irgendwie lebendig aus all dem herauskommen, nennt es die Enkelin.

Eines Tages sei sie vor den Bomben in den Schutzkeller geflohen, gemeinsam mit ihrer Schwester und deren neugeborenem Baby. Als die Detonationen endlich abebbten, alles für dieses eine Mal wieder vorbei war, hielt die Schwester einen Leichnam im Arm …
Oft habe Ingeborg davon erzählt, wie die Stadt brannte. Durch die Straßen seien sie geirrt, ihre Mutter und sie, als die Kriegswirren sie voneinander trennten. Laut hätte sie den Namen der Mutter gerufen, in der Hoffnung, sie hierdurch wiederzufinden, allem Getöse einstürzender Häuser und Feuersbrünste zum Trotz. Mitten darin, wo nichts zu sehen war, nur Rauch und Hast und Ruinen, habe sie der Mutter antwortenden Ruf gehört: ›Ingeborg, Ingeborg!‹ So hätten sie einander – ausgebombt – wiedergefunden …

Manchmal nahm sie später noch ein Photo zur Hand, auf dem nichts zu sehen war, außer ein Berg Schutt, wo zuvor das Wohnhaus gestanden hatte.
Das Er- und Überleben des Krieges jedenfalls brachte Ingeborg zu einer Überzeugung, an der sie bis an ihr Lebensende festhielt: Nie wieder Krieg! Nie wieder dürfe es zu solchem Wahnsinn kommen! Das wünsche sie ihren Enkel*innen, dass sie derartige Zeiten niemals erleben müssen.
Während ich diese Kolumne korrigiere, denke ich an das vergangene Wochenende: Ich verbrachte den Wahlsonntag mit Magdeburger Freund*innen. Im Hintergrund lief leise die Berichterstattung zur Landtagswahl, stündlich die Hochrechnungen. Und obgleich die Aktivitätsmöglichkeiten der diesjährigen Wahlkampagnen C-bedingt begrenzt waren, größere Partei-Veranstaltungen nicht wie gewohnt stattfanden, fiel das Blau auf, nicht bloß in der Bildgestaltung. Zwei Parteien im gleichen Farbton: Für Heimat und ›Wir‹. Samt und sonders ›Freiheit‹. Der in Wahrheit kein Boden bereitet wird, nicht nur weil diese ›Freiheit‹ schwammig bleibt, denn ihr soll auch gar kein Boden gewährt werden, schließlich hat man sowieso anderes im Sinn. Solches kann man recht deutlich auf diesen Plakaten lesen, studiert man sie, setzt man sie zueinander in Bezug: Jene ›Freiheit‹, die hier gemeint wird, bedeutet in Wirklichkeit Gefangenschaft im Irrsinn der erhobenen Hand.
Der Unfähigkeit zur Reflexion wird leider kein Ende gesetzt – ebenso wenig wie in all den anderen Nationen, die weiter und weiter nach rechts gleiten. Wir, in Österreich, können ja gleichfalls ein elendes Lied davon singen …
Man wolle, tönte man in Sachsen-Anhalt, stärkste Partei im Land werden. Nun, am Ende dieses Wahlsonntags stand fest, das gelang nicht. Aber ›beruhigend‹ würde ich es trotzdem keineswegs nennen, wenn jeder 5. das Außen im Extrem gewählt hat.
Die Stimmung meiner Magdeburger Freund*innen und meine eigene blieb und bleibt gedrückt; die Analyse, welche Jahrgänge sich für deren ewig-gestrige Botschaften, für deren Angsthetze begeistern, stimmt kaum optimistischer.
Nie wieder dieser Wahnsinn, war die Lehre der Generation, die den Zweiten Weltkrieg überlebte. Sie wussten, wovon sie sprachen. Und wir, ein Menschenleben später, sind drauf und dran, weltweit zu riskieren, dass zurückkehrt, wovon sie sprachen. Weil wir zu lahmarschig sind, zu sehr mit Alltagstrallala und -kleinkram beschäftigt, um uns um die entscheidenden Fragen zu kümmern. Ich nehme mich da selbst auch gar nicht aus. Zu matt und zu erschlagen oft, um tagtäglich diese Erde nicht zugrunde zu richten, um Widerstand zu leisten. Dann aber, dürfen wir uns nicht wundern … Das beherrscht das Gespräch, an jenem Sonntag. Eine mehr als bloß gedämpfte Stimmung macht sich breit, zieht sich in die nachfolgenden Tage …
Nie wieder solcher Wahnsinn, dem seien die nächste Generationen vor, die damit heranwuchsen. Erzählte Ingeborg ihrer Enkelin von den Kriegsjahren, so geschah dies stets ungemein fesselnd, weshalb ›der Krieg‹ für ihre Enkelin einst, als Kind, zu einer spannenden Geschichte wurde, die weit, weit zurück lag, vorerst unwirklich wie eine Erzählung aus dem Märchenbuch oder der Sagenwelt. Heute, als Erwachsene erklärt sie sich dieses Phänomen dadurch, dass es für Nachgeborene unbegreiflich sei, dass ein Mensch solche Schrecken erlebe. Schon gar nicht sei es zu begreifen, dass es die eigene Großmutter war, die solches überlebte, auch weil zwischen der Erzählung der 1940er-Jahre und jenem ›Jetzt‹ in den 1980er Jahren eine derartige Diskrepanz bestand, ein gänzlich anderer Alltag in anderer Welt, der sich einem zuhörenden Kind ohne Hintergrundwissen entzog.
Während der letzten Kriegsjahre verliebte sich Ingeborg. Eine Heirat in Kriegsarmut. Ein erstes Kind, eine Tochter. Doch der Mann stammte nicht aus Magdeburg, sondern aus heutigem Oberösterreich. Deshalb verließ Ingeborg am 21. Oktober 1946 die Stadt mit ihrer kleinen Tochter. Es war einer der letzten Züge, die noch Flüchtlinge transportierten. Bis zum 6. Dezember dauerte diese Fahrt, für die heute gerade mal sechs Stunden benötigt werden! Wiederholt wurden die Waggons auf Nebengleisen abgestellt, tagelang warteten die Menschen auf die Weiterfahrt. Kalt sei es gewesen, erzählte Ingeborg später, erschreckend kalt, und wie froh sei sie gewesen, dass ihre kleine Tochter, erst ein paar Monate alt, während dieser ewig nicht enden wollenden Fahrt so ungemein brav gewesen sei. Nicht auszudenken, wie schwierig dieses Unterwegssein sich hätte gestalten können, wäre die Kleine krank geworden oder hätte sie auch bloß den dicht gedrängten Waggon mit dauerhaftem Quängeln gefüllt …

Die ersten Jahre in der Fremde fielen Ingeborg nicht leicht – aus mehreren Gründen: Attnag-Puchheim war in den letzten Kriegstagen gleichfalls noch bombardiert worden, und wiewohl diese Erfahrung alle hätte einen können, trat eher das Gegenteil ein. Es schürte Konflikte. Als Deutsche weithin sprachlich erkennbar, schloss sich Ingeborg während jener ersten Zeit vor allem zwei ihrer Landsfrauen an, deren Bekanntschaft sie durch Zufall in Attnang-Puchheim machte und mit denen sie die Situation, neu in der Region und frisch verheiratet zu sein, ebenso teilte wie die Erfahrung eines ihr rau dünkenden Umgangstons an diesem neuen Wohnort. Hinzu kam, dass sie auch als Schwiegertochter offenbar nicht willkommen war, was den Neubeginn keineswegs leichter gemacht haben dürfte.
Der erste Unterschlupf des jungen Paares war eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, in der es tagein, tagaus furchtbar kalt war. Alte Konservendosen dienten als Ersatz für Kochtöpfe – ein bitteres Erwachen für eine junge, gerade frisch verheiratete Frau mit einem kleinen Kind, so die Enkelin.
Zwei, drei Mal besuchte Ingeborg danach noch ihre Eltern in der DDR, doch habe es ihr jedes Mal das Herz gebrochen: Das Magdeburg, mit seiner tausendjährigen Geschichte, gab es nicht mehr, alles in Schutt und Asche. Wer darin lebt, sieht auch wie Neues entsteht. Wer jedoch nur für eine kurze Weile kommt, das ehedem gewohnte Bild noch immer konstant vor Augen, mit dem die Realität nicht mehr korrespondiert, den muss dies besonders schmerzen …
In späteren Jahren zog sie es daher vor, nicht zurückzukommen; postalisch aber blieb sie immer in Kontakt mit der alten Heimat, sandte Briefe und Pakete an Verwandte und Freunde, Strümpfe, Kaffee und was eben sonst noch benötigt wurde.
Das übliche Szenario bei geteilten Familien, mit einzelnen Mitgliedern im Westen, anderen im Osten, mir wohl vertraut in der polnischen, der kubanischen Variante, beobachtet auch an den ›Schatzis‹ im Kosovo (Siehe: »Kosovarische Korrekturen. Versuch über die Wahrheit.«). Es ist stets – für beide Seiten der geteilten Familien – eine komplexe Situation, die immer auch Konflikte und nicht zu lösende Verstrickungen mit sich bringt.
Nicht immer sei alles angekommen wie gedacht, erzählt mir die Enkelin, und dennoch habe ihre Großmutter Ingeborg daran festgehalten. In den späten 1970er Jahren seien manchmal auch Pakete aus der DDR gekommen, Bucheinbände aus Leder, eine Federschachtel, Puppenkleidung …

Wie das denn empfunden worden sei, frage ich. Diese Pakete aus der DDR?
Heute geniere sie sich manchmal, dass sie damals Geringschätzung empfand, für jene Präsente, doch habe man sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, und so sei es eben gewesen: eine Irritation, ein Nicht-Wissen, was anfangen, mit diesen eher altbackenen Geschenken, die man sich selbst wohl kaum ausgesucht hätte. Kinder können darin sehr hart sein, sagt sie und verstummt für eine Weile, bevor sie ergänzt: Einblicke in die politischen Zusammenhänge seien ihr damals noch verwehrt gewesen, viel zu verwirrend, das alles: Wie sollte man verstehen, dass neben der gewohnten und bekannten eigenen Welt noch eine weitere existiere? Mal davon abgesehen, dass ihr durchaus klar gewesen sei, auch als Kind schon, dass diese Verwandten und Freunde der Großmutter in ihrer Freiheit geknebelt waren – »und schaute man einmal ›falsch‹, hatte man nichts mehr zu lachen«, formuliert es die Enkelin.
Das Federpennal besitze sie heute noch, auch zwei Puppenpyjamas seien erhalten – und die Briefe. Vor allem die Briefe. Manchmal nehme sie diese zur Hand, und die Liebenswürdigkeit darin erstaune und berühre sie bis heute. Vielleicht, so sagt die Enkelin, sei dies ein Spezifikum der Menschen aus dem Osten: eine Liebenswürdigkeit, eine Aufrichtigkeit, eine gesunde Bescheidenheit auch; und vor allem: die Fähigkeit zum Zusammenhalt – natürlich könne man das nicht so pauschalieren, es gelte nicht für alle, aber es sei eine auffallende Tendenz. Darin hätten sie uns so manches voraus! Oder auch in der gepflegten Aussprache … Auf die hätte ihre Großmutter entschieden Wert gelegt, hätte sich sprachlich in all den Jahren in Oberösterreich nie an den anderen Ton angepasst, sondern den ihren beibehalten.
Eine Kunst, dieses Nein zur Vereinnahmung, nicht aufzugehen in dominanter Umgebung, sondern man selbst zu bleiben. Auch sprachlich.
Wie schwer das fällt, davon kann ich als österreichische Literatin ein Lied singen. Schon Karl Kraus schrieb, das Problem zwischen Deutschen und Österreichern sei die gemeinsame Sprache.
Ja, der andere Ton … er macht oft die Melodie, und an guten Tagen sammle ich die Varianten, bereichere mein Vokabular und mein Weltwissen um alle Nuancen, mögen sie aus Österreich, der Schweiz, aus Deutschland stammen; an schlechten Tagen habe ich die Nase voll und summe ein verärgertes Protestlied, gegen die oft zu Tage tretende Arroganz einer zahlenmäßigen Mehrheit, die nur aufgrund ihrer Menge zu dem Schluss kommt, dass ihre Sprachvariante nicht eine von drei existenten, lebendigen und gelebten Möglichkeiten der deutschen Hochsprache sein könne, sondern vielmehr: die einzig Wahre, die Korrekte, die Standardsprache! Weshalb alles andere zur Abweichung, zum Regelverstoß, zur Mundart erklärt wird. Aller Etymologie zum Trotz. Auf die wird einfach mal gepfiffen, ist ja nicht so wichtig, wenn die Mär doch schön klingt, nicht?
Das kann dann sogar sonderbar extremistische Tonlagen anstimmen, wie das Schreiben einer Hamburger Agentin, die ein Manuskript, dessen Inhalt in Österreich spielt, dessen Dialogtext von Österreicher*innen gesprochen wird, mit der Begründung ablehnte, vor einer Publikation müsse es ›ja erst einmal übersetzt werden‹, was das koste. Als ich mich – damals noch wahrlich naiv in Punkto Arroganz – ernsthaft erkundigte, in welche Sprache sie es denn zu übersetzen gedenke, um es einem Verlag anzubieten, wir sprächen doch von der hiesigen Verlagslandschaft, nicht wahr? Oder wolle sie es zeitgleich im fremdsprachigen Ausland platzieren? Da erhielt ich die obskure Antwort: Ins Deutsche.
Zum Totlachen. Wäre es nicht derart bedauerlich.
Das Drama beginnt aber nicht jenseits der Weißwurstgrenze, wie dieses Exempel einem suggerieren könnte! Das Drama beginnt bereits in Kärnten in den 1980er Jahren, als man sich der Anbiederung an deutsche Gäste wegen entschloss, ihnen in der Aktion einer Bäckerei »6 Brötchen« zu offerieren. Sie währt bis heute in Salzburg, wenn der Quark auf die Torte kommt, die nichts anderes als eine Topfentorte aus dem Sacher-Kochbuch ist. Das Problem bei alldem sind ja nicht bloß deutsche Deutsch Sprechende, das Problem sind vor allem auch die österreichischen Deutsch Sprechenden, die keineswegs in aller Ruhe ihre Semmel Semmel nennen, den Topfen kaltstellen und ihren Kasten souverän in ihren Wohnungen öffnen und schließen können, befinden sie sich südöstlich von Schärding/Passau; nördlich davon sollte es durchaus ein Schrank sein, wohnt die Protagonistin in Berlin oder Lübeck! Und ist sie nicht eine eben erst Zugezogene – aus Österreich. ›Duktus‹ nennt sich das im Roman – und im Alltag?
Statt ein entschiedenes Veto einzulegen, gegen sprachgeschichtliche Unwissenheit, statt einen Beitrag zur Weiterbildung der norddeutschen Sprachgenossinnen zu leisten, gefallen sich Österreicher*innen offenbar im Verschluckt-Werden durch die Mehrheit. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, wir hätten diesbezüglich einen kollektiven Minderwertigkeitskomplex: Mit Sicherheit ist alles korrekter, besser, wahrer nördlich der Weißwurstgrenze. Eine mir unverständliche Haltung, nicht nur weil sie jede Sprachhistorie ignoriert, sondern auch weil ich die Schönheit und den Reichtum der österreichischen Hochsprache und ihrer mundartlichen weiteren Sprachvarianten viel zu sehr schätze, um darauf in der Literatur verzichten zu wollen.
Eine solche Besonderheit ist zum Beispiel die sanfte Weite der Vokale, welche Nonchalance genießt und dieses Wohlgefühl auch gerne kolportiert, statt mit ausgefahrenen Ellenbogen einher zu poltern, und jeden zu puffen und zu knuffen, der zufällig des Weges kommt. Lauschen Sie Oskar Werner, wenn Sie mir nicht glauben, wie herrlich österreichisches Hochdeutsch klingen kann. Das begriff übrigens bereits meine Mutter. Kaum war der gute Herr Werner im Radio zu hören, wurde der Befehl erteilt: ›Still, Mädels, hört zu! Das ist Oskar Werner, der spricht!‹ Und standen »Das Narrenschiff« oder »Fahrenheit 451« am Fernseh-Programm führte kein anderer Film an diesen vorbei, was auch durchaus in meinem Sinn damals war.
Eine weitere Besonderheit ist der Spiegel der Geschichte, die sich in die österreichische Sprachvariante einschrieb und ihr aufgrund von ›tu felix Austria nube‹ (›du, glückliches Österreich, heirate‹) sagenhaften Sprachreichtum brachte. Österreichisches Deutsch wimmelt von ursprünglich böhmischen und jiddischen Wörtern, verweist ab und an auf das Ungarische, zwinkert dem Italienischen zu und karessiert das Französische. Wieso in aller Welt sollten wir darauf verzichten wollen? Schon mein Großvater steckte sein Portemonnaie ein, wenn er über das Trottoir zum Salon seines Bruders ging. Manchmal auch um ebenda, nach erfolgtem Haarschnitt, frappiert festzustellen, er habe - seiner Seel! – keine Moneten darin, was sein Bruder stets als Chuzpe wertete – na warte, dir werde ich es zeigen! Aber Großvaters ›Habe die Ehre!‹ war immer flinker als das Beiseite der Schere, des Kamms, der Bürste: Auf die Mischpoche war eben (kein) Verlass …
Die dritte Besonderheit aber, die dünkt mir einen tiefen Einblick in die österreichische Seele zu geben: Wir haben die Eigenheit, die Sprachschichten zu wechseln, uns da wie dort und überall zu bedienen, sodass in einem Satz in Hochdeutsch plötzlich ein umgangssprachliches Wort vorkommen darf oder in einem umgangssprachlichen Satz ein hochdeutscher Terminus hervorblitzt. Das aber hat keineswegs damit zu tun, dass wir in den Mund nehmen, was uns gerade einfällt, sondern weil jenes eine Wort – Fremdkörper hin oder her –, in jenem Satz just die gewünschte Nuancierung mit sich bringt, eine Betonung setzt, eine inhaltliche Akzentuierung vornimmt.
Also, liebe Österreicher*innen, schreibt’s euch das hinter die Ohrwascheln, vergesst endlich das dumme Anbiedern, nehmt euch doch ein Beispiel an den Schweizer*innen und bedenkt: Wir hätten ansonsten den Ruf der gelassenen Großzügigkeit zu verlieren! Die Vertreter*innen der deutschen Sprachvariante sind nämlich durchaus ebenso lernfähig wie wir – es dauert bloß ein bisserl länger, wie nachfolgende Magdeburger Alltagsszene zeigt:
Zwei in einer Küche, eine ist damit beschäftigt ein spätes Mittagmahl zuzubereiten.
- Soll ich dir helfen …?
(Mitten hinein gesprochen in das Rauschen des Wassers. Spülgeklapper.)
- Magst vielleicht die Fisolen schneiden?
- Die … Fi-?
(Suchender Blick, Ratlosigkeit.)
- Na, die Fisolen … (Es dämmert, dass es sich nicht um ein akustisches Problem handelt. Ein bundesdeutsches Pendant mag nicht einfallen.) … dort im Sieb, die grünen Schoten, die neben dem Kasten. Sind schon gewaschen.
- Ah. – Wie sagt ihr dazu? Fi-?
- Fisolen. Und ihr?
- Grüne Bohnen. Fisolen, eigentlich logisch, wie ›fagioli verdi‹ auf Italienisch … Und in Spanien?
- … die Spanier*innen unterscheiden – ›frijoles‹ für die Bohnen an und für sich, ›judías verdes‹ für die grünen Schoten.
- Und was sagen die Franzosen?
- ›Haricots verts‹.
- Hm. Nur den ›Kasten‹, den verstehe ich nicht.
- ›Schrank‹ sagt ihr. Und wollen wir Erdäpfel dazu? Die gab es zwar gestern schon, aber …
- Deutsche können täglich Erd-Äpfel essen.
- Ösis auch. Beinahe.
(Langsam versteht man einander: Frohgemutes Werken für baldigen kulinarischen Genuss.)
- Dann rühr ich schon mal den Rahm an. Moment. Den gibt es ja nicht, den Rahm. Bloß Schmand. Geht der auch? Kann man den – kochen?
(Zu diesem Zeitpunkt, unweigerlich erneut: Irritation auf beiden Sprachseiten; wiewohl aus unterschiedlichen Gründen.)
Bevor ich nun aber in den Ruf der Dumas’schen Zeilenschinderei gerate, schließe ich diese Küchentür. Sollen die beiden diese Knochen doch allein abnagen, sie tun es sicherlich noch seitenweise. Außerdem schaut man doch keinem beim Essen auf den Mund, oder?
Stattdessen sei deutschen Leser*innen das Abenteuer geraten, ihre Kenntnisse deutschsprachiger Sprachgeschichte und Sprache zu erweitern: Vermutlich fände sich mancher Reichtum auch für sie darin.
Nur ein Beispiel: Es ist wohl kaum einzusehen, weshalb ein Wort wie ›Jänner‹ (Erbwort zu mittelhochdeutsch ›jenner‹, entstanden aus vulgärlateinisch ›Iēnuārius‹, welches folgsam alle Lautwandelprozesse durchlief) weniger geeignet sein sollte, die Kälte des ersten Monats im Jahr einzufangen, als der gähnende ›Januar‹, der weitaus später, nämlich erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auftauchte, und seither als alleiniger Herrscher einherschreiten mag …
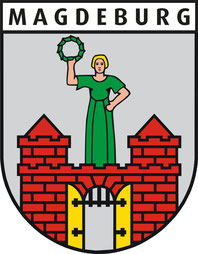
Alle etymologischen Studien zum Trotz wissen wir aber nun noch immer nicht, was die erste Silbe in Magdeburg soll. Ich habe im Rahmen dieser Kolumne schon einmal darauf hingewiesen, dass wer, aus dem Schriftbild kommend, sich über die Lautgestaltung dieses Ortsnamens wagt, einen Rüffel riskiert. Dieser trifft unweigerlich auch diejenige, die ganz naiv aus junger, wackerer Maid mit Siegeskranz im Stadtwappen den Schluss zieht, man habe es mit einer ›Magd‹ zu tun, weshalb die gute Frau im Anlaut-[a:] schön offen und lang tönt, je südlicher die Herkunft des Sprechenden ist, je stärker ausgeprägt die Weite des [– a: –]: Man möge ihnen die Unfähigkeit zur ›Mgd‹ lächelnd verzeihen und rufe sich in Erinnerung, der Rest der Welt übe sich noch in hiesiger Knappheit. Irgendwann werden sie es schon lernen …
Mir persönlich gefällt unter allen Bedeutungsvorschlägen zu diesem auffallenden Ortsnamen der augenzwinkernde Ansatz der Magdeburger Sprachwissenschaftlerin Ursula Föllner, die im »Magdeburger Lesebuch« schrieb:
»Bis zur endgültigen Enthüllung des wahren Ursprunges nehmen wir doch einfach an, Magdeburg war eine mächtige Hauptstadt, in der heidnische weibliche Wesen verehrt und geschützt wurden und die von einem Blütenmeer aus Kamillen umgeben war, in dem die Honigbienen fleißig umherflogen. Das ist doch eine wunderbare Vorstellung!«
Sic est! (So ist es!)